„Ausruhen konnte man sich in dem Job noch nie“
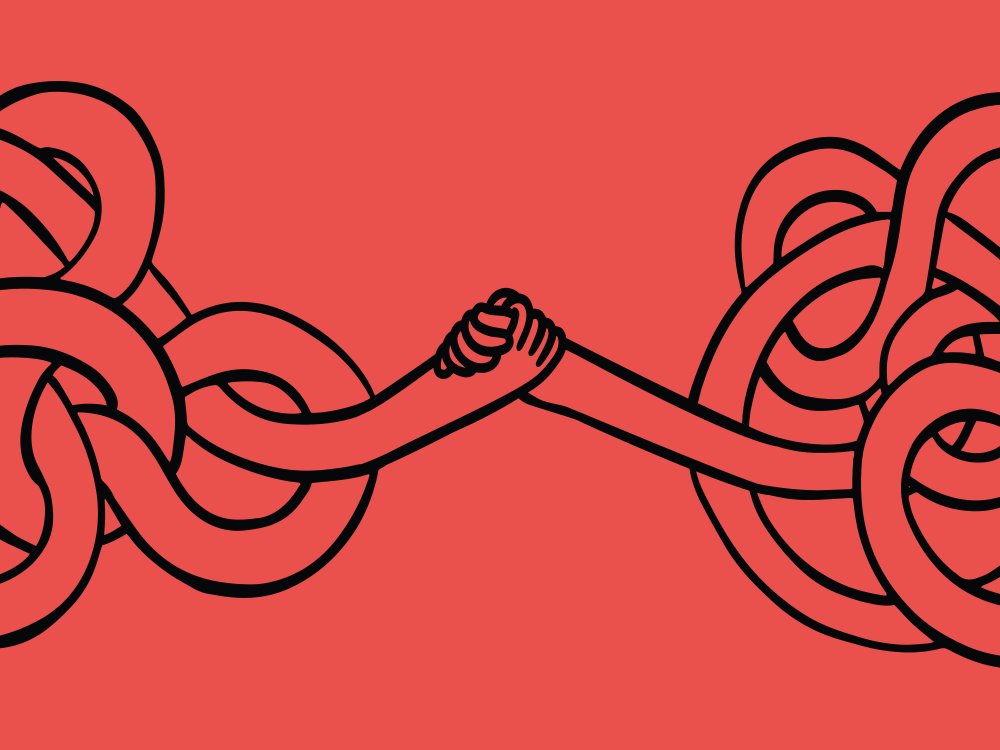
„Das sind oft systemische Probleme: zu viel Arbeit, zu hohe Erwartungen, das Gefühl, nicht gehört zu werden. Dazu die Umstrukturierungen“, sagt Ute Korinth, Mitglied des DJV-Bundesvorstands. Illustration: IStock / Iuliia Morozova
Journalistinnen und Journalisten klagen über psychische Belastungen. Unterstützung gibt es bei der Helpline des Netzwerks Recherche. Der journalist hat Malte Werner (Leiter) und Ute Korinth (DJV) gefragt: Sind wir weicher geworden oder der Job zu hart?
Interview: Maximilian Münster
07.11.2025
Es ist unser Job, über Krisen zu berichten. Über die eigenen sprechen wir selten. Dabei sind psychische Belastungen Alltag , viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu viel und stehen unter enormem Leistungsdruck. Dazu die ständigen Umbrüche in der Branche. Im Interview mit dem journalist sprechen Malte Werner und Ute Korinth von der Helpline des Netzwerks Recherche darüber, woran der Journalismus krankt.
Liebe Ute, lieber Malte, würdet ihr es Kolleginnen und Kollegen erzählen, wenn ihr unter psychischen Belastungen leidet?
Ute Korinth: Ja, ich würde es sagen, wenn es mir nicht gut ginge.
Malte Werner: Ich mittlerweile auch. Bei der Helpline reden wir natürlich offener über solche Probleme. Wäre ich in einen stressigen Redaktionsalltag eingebunden, wäre es etwas anderes. Da würde es auch darauf ankommen, ob ich in einer Umgebung arbeite, die für solche Themen sensibilisiert ist.
Werden psychische Leiden in Redaktionen stigmatisiert?
Malte: Teilweise. Es kommt auf die Vorgesetzten an, welche Hauskultur sie schaffen. Da gibt es immer noch alte Knochen, die glauben, alles was mit psychischer Gesundheit zu tun hat, ist Quatsch.
Sind junge Onlineredaktionen sensibler als eine traditionelle Lokalzeitung?
Ute: Nein, an der Art des Mediums lassen sich keine generellen Unterschiede festmachen. Auch manche moderne Redaktionen geben zwar nach außen vor, eine offene Kultur zu leben, bei genauerem Hinsehen zeigt sich dann aber, dass innen hierarchische Strukturen und sehr viel Druck herrschen.
Malte: Und umgekehrt sitzen in vermeintlich piefigen Lokalredaktionen Leute, die super offen sind. Ich habe in dem Bereich Leute kennengelernt, die haben sich zu psychischen Ersthelfern ausbilden lassen.
Worüber klagen die Kolleginnen und Kollegen, die bei euch anrufen?
Malte: Oft geht es um Zukunftsängste, weil die Menschen nicht wissen, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Aber die meisten leiden unter beruflichem Stress, der meistens mit privatem Stress einhergeht. In wenigen Partnerschaften kommt es gut an, wenn ein Teil nach Feierabend noch am Rechner sitzt.
Woher kommt der Stress?
Ute: Das sind oft systemische Probleme: zu viel Arbeit, zu hohe Erwartungen, das Gefühl, nicht gehört zu werden. Dazu die Umstrukturierungen.
Malte: Da fühlt man sich als Einzelner überlastet. Man denke an Lokalzeitungen, wo es immer neue Sparrunden gibt und die Leute nicht wissen, wie sie fünf Texte am Tag schreiben sollen. Recherchen sind da schon lange nicht mehr drin. Was wir oft hören: Prozesse ändern sich so häufig, dass die Leute gar nicht mehr verstehen, warum. Ständig wird ein neues Content-Management-System eingeführt, Ressorts zusammengelegt oder neue Konferenzen einberufen. Das frisst Zeit und baut riesigen Stress auf. Die Leute gehen irgendwie mit, aber sie sehen die Vorteile nicht mehr.
Ute: Medienhäuser übergehen bei Veränderungen häufig die Bedürfnisse der Angestellten. Das geschieht nicht mal bewusst. Beim Thema gesundes Change-Management ist noch Luft nach oben.
Wegen körperlicher Attacken oder Hasskommentaren rufen die Menschen nicht an?
Ute: Anfangs dachten wir, wir sprechen hauptsächlich mit Menschen, die auf Demos attackiert wurden oder andere traumatische Erfahrungen gemacht haben. Aber das sind vergleichsweise wenige.
Malte: Journalistinnen und Journalisten, die Gefahren ausgesetzt sind, bekommen meistens sowieso eine gute Betreuung. Kriegsreporterinnen und -reporter zum Beispiel arbeiten für große Häuser, wo es nach ihren Recherchen Gesprächsangebote gibt.
Ute: Das Problem ist: Wenn es Hilfsangebote gibt, denken Medienhäuser in vielen Fällen die Freien nicht mit. Da gibt es eine große Dunkelziffer, was die psychischen Belastungen angeht. Wir sagen den Redaktionen immer: Denkt an die Freien!
Im Frühjahr hat die Ludwig-Maximilians-Universität München eine Studie herausgebracht: Das psychische Wohlbefinden von Journalistinnen und Journalisten ist schlechter als in der Gesamtbevölkerung, das Burnout-Risiko hoch. Fast zwei Drittel erwägen, aus dem Beruf auszusteigen. Wird die Branche kränker oder spricht sie nur offener darüber?
Malte: Der Druck wird definitiv größer, die Digitalisierung fordert mehr vom Einzelnen. Ich glaube aber, hätte die LMU die Studie vor 30 Jahren gemacht, wäre das Ergebnis nicht besser ausgefallen. Ausruhen konnte man sich in dem Job noch nie.
Ute: Es war schon immer stressig. Wenn ich an meine ersten Praktika denke, da gab es auch schon Leute, die haben Kette geraucht und hatten ein Alkoholproblem. Trotzdem glaube ich, dass die Branche kränker wird und deshalb offener darüber spricht. Die Arbeitgeber verstehen auch mehr als früher, dass es für sie teuer wird, wenn ihre Mitarbeitenden krank werden, als wenn sie mehr Geld in Prävention stecken.
Malte: Wenn früher jemand wegen Burnout ausfiel, war die Personalausstattung so üppig, dass Medienhäuser das auffangen konnten. Heute geht das nicht mehr, das Personal fehlt. Das spüren Arbeitgeber extrem.
Ute: Deshalb können sie gar nicht anders, als sich mit der psychischen Gesundheit ihrer Angestellten zu beschäftigen und Hilfsangebote aufzubauen.
Liegt es auch daran, dass gerade eine Generation in die Redaktionen einzieht, die psychische Gesundheit häufiger thematisiert und das auch vom Arbeitgeber einfordert?
Malte: Ja, viele junge Leute in den Redaktionen sprechen offener darüber. Aber die älteren Kolleginnen und Kollegen auch, man muss sie nur etwas anpieksen. Wir haben schon Workshops in Redaktionen gemacht, da haben wir die erste Frage gestellt und die Leute haben losgeredet. Wir konnten sie kaum stoppen.
Was die Studie der LMU auch gezeigt hat: Konkurrenzdruck ist sehr belastend. Sind wir mehr Konkurrenten als Kollegen?
Malte: Wenn man aufs Dashboard schaut und sieht, dass der Artikel vom Kollegen sich besser klickt, macht das Riesendruck.
Ute: Ich glaube aber, dass die Ellenbogen-Mentalität zurückgeht, gerade bei der jüngeren Generation. Sie hat ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man gemeinsam besser im Job besteht.
Trotzdem müssen junge Menschen hervorstechen, um Karriere zu machen. Die Branche fördert das mit Journalistenpreisen. Auch Journalistenschulen können Konkurrenzdenken befördern.
Ute: Das ändert sich. Viele junge Menschen gehen nicht in den Journalismus, um Karriere zu machen. Umfragen zeigen, dass Führungspositionen nicht mehr so wichtig sind. Es geht eher um Sinnhaftigkeit. Darum, etwas zu bewegen.
Malte: Ich sehe schon das Risiko für Konkurrenzdenken. Wen loben wir in der großen Montagskonferenz? Natürlich die Person, die die tolle Seite 3 geschrieben und dafür zig Überstunden gemacht hat. Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber es macht anderen Druck, immer die Extrameile zu gehen. So nehmen Redaktionen in Kauf, dass Leute ausbrennen. Redaktionen müssen öfter diejenigen loben, die gutes Handwerk im Rahmen des Möglichen geleistet haben.
Manche Belastungen lassen sich nicht vermeiden. Nachrichtenredakteure müssen Bilder aus Krisengebieten sichten, Lokalreporter werden auf Demos beschimpft. Sind manche Menschen zu weich dafür?
Malte: Resilienz ist bei jedem anders ausgeprägt, einige sind schneller emotional involviert als andere.
Ute: Ich habe schon häufiger erlebt, dass Menschen, die meinten, besonders resilient zu sein, gar nicht gemerkt haben, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Das spürt eher das Umfeld, weil die Person weniger fröhlich oder leistungsfähig ist, stiller wird. Sensiblere Menschen wissen hingegen eher, wie sie auf sich Acht geben müssen und kennen ihre Grenzen besser.
Redaktionen stehen sowieso schon unter Druck. Wie sollen sie sich auch noch um die mentale Gesundheit der Mitarbeiter kümmern?
Malte: Sich zu kümmern, muss nicht bedeuten, dass jeder Verlag einen Hauspsychologen anstellt. Aber die Kultur muss stimmen. Sagen wir, eine Kollegin recherchiert zu Kinderpornografie. Dann muss sie ihren Vorgesetzten um Hilfe bitten können. Zum Beispiel darum, dass er ihr einen Kollegen zur Seite stellt, um über die Recherche zu sprechen. Oder um Unterbrechung der Recherche, wenn sie gerade nicht mehr kann. Man muss nicht dreimal wöchentlich über mentale Gesundheit sprechen, aber vielleicht hilft am Anfang der Montagmorgenkonferenz ein kurzer Batterie-Check: Habt ihr Energie oder seid ihr leer, obwohl die Woche erst angefangen hat?
In aktuellen Redaktionen ist der Alltag eng getaktet. Raubt das nicht zu viel Zeit?
Malte: Zumindest der Batterie-Check muss möglich sein, der dauert nur fünf Minuten und zeigt, wie belastet ein Team ist.
Ute: Wenn du zwischendurch Pause machst, bist du hinterher effektiver und kreativer, das ist bewiesen. Pausen sparen Zeit.
Das ersetzt den Psychologen?
Malte: Nein. Traumatisierte Kolleginnen und Kollegen brauchen professionelle Betreuung. Viele Medienhäuser beauftragen externe psychologische Dienstleister. Das Problem ist, dass die sich oft nicht mit den besonderen Begebenheiten des Berufs auskennen. Eine Person hat uns mal eine Situation geschildert, in der sagte der Psychologe: „Wenn der Job zu stressig ist, machen Sie doch was anderes.“ Das bringt einem natürlich nichts.
Ute: Das ist wiederum unser Vorteil bei der Helpline: Wir sind selbst Journalistinnen und Journalisten und können die Probleme der Leute nachvollziehen. Sie merken, dass sie nicht allein sind und dass ihre Emotionen berechtigt sind.
Wie laufen die Gespräche bei der Helpline ab?
Ute: Oft brechen die Sorgen aus den Leuten heraus. Wir hören erst zu, dann fragen wir: Was ist dir gerade am Wichtigsten? Das hilft schonmal, sich auf das Kernproblem zu fokussieren. Mit einer Atemübung oder sogar mit einer kleinen Meditation. Wir versuchen dann, das Gespräch auf die Stärken zu lenken: Wann ging es dir gut? Welche Herausforderung hast du richtig gut bewältigt? Wer hat dich da unterstützt? Welche Tools haben dir geholfen? So kann es laufen, aber jedes Telefonat ist anders.
Könnt ihr den Menschen helfen, die bei euch anrufen?
Malte: Ich habe schon den Eindruck. Wir tauschen uns nach den Telefonaten kurz aus. Jeder sagt, was das Thema des Anrufs war, zum Beispiel Stress oder Angst, und oft schreiben die Mitarbeiter noch: Anrufer war dankbar und zeigt sich erleichtert.
Ute: Meistens geht es um Probleme, die sich lange aufgebaut haben und die die Menschen mit sich herumschleppen. Dann stehen sie vielleicht schon kurz vor der Kündigung, zumindest vor der inneren Kündigung, und rufen an. Und ja, es kann sein, dass nach einem Gespräch Entscheidungen klarer sind.
Ihr wurdet von einer Psychotherapeutin geschult. Was habt ihr gelernt?
Ute: Ich habe gelernt, dass ich nicht immer helfen kann, auch wenn ich mir das wünsche. Ich nehme mich mehr zurück und höre intensiver zu, halte Gesprächspausen aus. Mit super Ideen zu kommen, ist meistens kontraproduktiv. Das Ziel ist, die Leute dahin zu bringen, dass sie selbst eine Lösung entwickeln.
Malte: Das geht mit Gesprächstechniken wie aktivem Zuhören, Rückfragen stellen und empathischen Reaktionen. Wir haben gelernt, psychologische Erste Hilfe zu leisten und die Symptome von Burnout und Traumata zu erkennen. Die Telefongespräche haben wir bei Rollenspielen simuliert.
Geratet ihr manchmal an eure Grenzen?
Ute: Wir betonen in jedem Gespräch, dass wir keine Psychologinnen sind und dass die Helpline keine Therapie ersetzt. Wenn jemand wirklich psychologische Hilfe braucht, haben wir eine Reihe von Beratungsstellen, an die wir verweisen. Aber unsere Schulung hat uns auf alles Mögliche vorbereitet. Auch darauf, dass eine Person anruft und Suizidgedanken äußert.
Kam das schonmal vor?
Ute: Nein, zum Glück noch nie.
Malte: Anfangs hielten wir das für möglich. Es gab bisher aber erst zwei, drei sehr belastende Telefonate, die unsere Mitarbeitenden an ihre Grenzen gebracht haben. In solchen Fällen können sie selbst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.
Habt ihr Tipps, wie Journalistinnen und Journalisten gelassener im Job werden?
Malte: Ganz simpel: Wenn ich eine Arbeitszeit von 40 Stunden habe, sollte ich nicht 50 Stunden die Woche arbeiten. Natürlich sind Überstunden im Journalismus manchmal nötig, dann muss ich sie aber ausgleichen. Ich muss klar mit Vorgesetzten kommunizieren: Ich schaffe nicht alle Texte, welchen kann ich weglassen? Wann kann ich meine Ausgleichstage nehmen? Ich selbst habe früher unfassbar viele Überstunden gemacht, mittlerweile nicht mehr.
Das können junge Journalisten mit befristeten Verträgen doch nicht sagen.
Malte: Ich verstehe die Befürchtung. Aber mit guten Argumenten bekommt man seinen Standpunkt bei Vorgesetzten durch, das ist meine Erfahrung. Wenn man sagt: Ich leiste gute Arbeit, meine Texte sind fundiert recherchiert. Aber die Qualität kann ich bei diesem Arbeitspensum nicht aufrechterhalten.
Ute: Bei Freien ist es nochmal ein bisschen anders. Viele trauen sich nicht, Aufträge abzulehnen aus Angst davor, keine mehr zu kriegen. Da fehlt schon noch das Bewusstsein in der Branche, dass es okay ist, wenn die Leute auf sich achten.
Die meisten sehen im Journalismus mehr Berufung als Beruf. Ist das nicht das größte Problem?
Ute: Für etwas zu brennen, ist ja erstmal positiv. Und Journalismus als 9-to-5-Job wird nie funktionieren.
Malte: Genau, weil sich die Weltlage nicht nach Arbeitszeiten richtet. Journalismus als Berufung zu begreifen, weil ich den Job gut kann, Freude daran habe und Sinn darin sehe, kann emotional bestärken. Aber es kann auch kippen: Die Gefahr ist groß, dass die Leute verbrennen. In der Pflege sind die Burnout-Raten ähnlich hoch wie im Journalismus. Wir müssen uns vor Überidentifikation schützen.
Wie meinst du das?
Malte: Unsere Aufgabe ist es, Menschen über Vorgänge und Ereignisse zu informieren. Aber wir können die Welt nicht retten. Wir können zum Beispiel mit Zahlen zeigen, dass der Klimawandel real ist. Aber wenn die Leute und die Politik Klimaschutzmaßnahmen nicht umsetzen, liegt das nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich. Ich glaube, wenn man die Aufgabe für sich klar hat, kann man mit dem Job besser umgehen.
Wie kriegen wir mehr Abstand zur belastenden Weltlage?
Malte: Das ist ein Problem des Systems, an dem der Einzelne wenig ändern kann. Wir produzieren eine Eilmeldung nach der anderen, sind gefangen im News Cycle. Müssen wir über alles berichten, was Trump wieder gemacht hat? Die alte Debatte.
Ute: Niemand liest die zigtausend Meldungen, die Medien in Deutschland produzieren. Es würde uns helfen, wenn wir zurückgingen zu mehr Qualität statt Quantität, zu mehr Storytelling und konstruktivem Journalismus.
Wie soll das gehen?
Malte: Das müssen Chefredaktionen entscheiden.
Im vergangenen Jahr habt ihr eine Förderung der Bundesregierung bekommen, die zwei Jahre läuft. Die neue Bundesregierung wird wohl einige Förderprogramme stoppen. Wie wollt ihr euch künftig finanzieren?
Malte: Die Förderung sollte bis Ende 2025 laufen, einen Teil des Geldes haben wir gespart. Wir hoffen, den Förderzeitraum bis Ende 2026 verlängern zu können, dafür sprechen wir gerade mit dem Bundeskulturministerium.
Glaubt ihr, dass ihr danach noch Geld vom Bund bekommt?
Malte: Wir haben nie mit weiterer Förderung vom Bund gerechnet. Wir haben andere große Förderer, zum Beispiel SZ und Spiegel, DJV und Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wir wollen noch mehr Stiftungen gewinnen, die sich mentaler Gesundheit widmen. So wollen wir die Zukunft der Helpline sichern.
Ute Korinth arbeitet als Journalistin, Kommunikationsexpertin und Resilienzcoach in Dortmund und ist Mitglied im Bundesvorstand des DJV, der den journalist herausgibt. Sie ist ehrenamtliche Helferin bei der Helpline.
Malte Werner ist Journalist und leitet die Helpline bei Netzwerk Recherche.
Maximilian Münster arbeitet als Wirtschaftsjournalist in Berlin.