„Unter drei“ ist ein Demokratieproblem
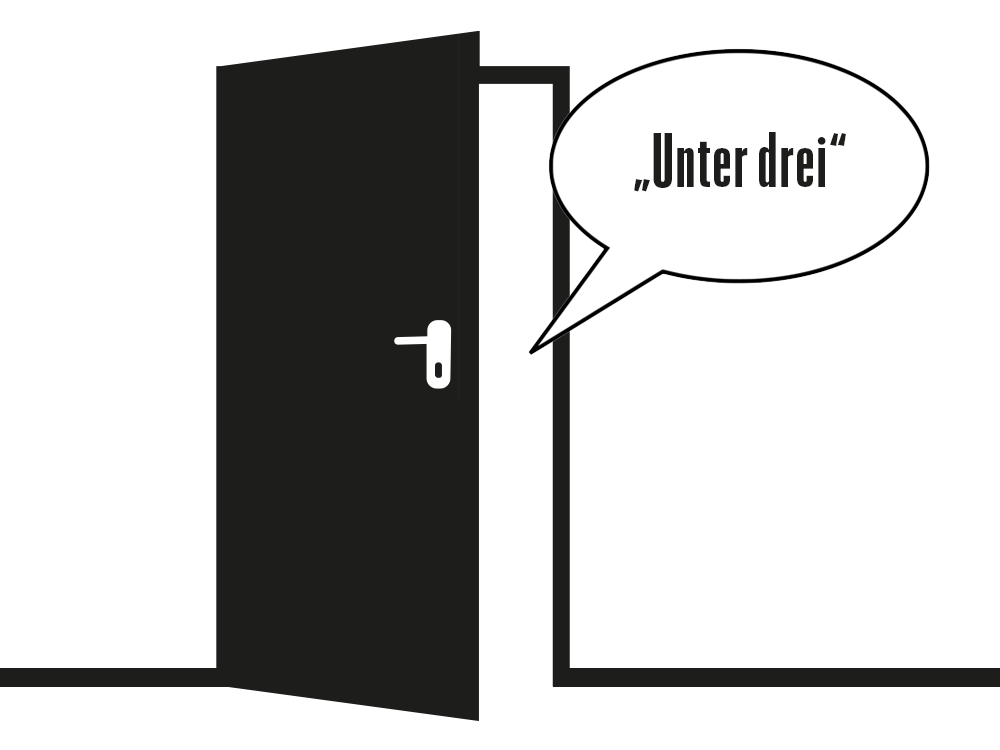
Die Satzung der Bundespressekonferenz, wonach Regierungsvertreter Mitteilungen gegenüber Journalisten auch „vertraulich“ gebenkönnen, hält Müller-Neuhof für kontraproduktiv.
Vertrauliche Hintergrundgespräche mit Regierungsbehörden machen Journalisten verdächtig und schädigen den Anspruch der Bürger, über Staatshandeln zutreffend informiert zu werden.
Text: Jost Müller-Neuhof
12.05.2025
Wer nach dem Zeitpunkt sucht, an dem Menschen aufgehört haben, eine gemeinsame Wahrheit zu teilen, wird für Deutschland im Jahr 2015 fündig. Eine Sprachjury rief damals „Lügenpresse“ zum Unwort des Jahres aus, das ostdeutsche Pegida-Spaziergänger in die bürgerliche Mitte getragen hatten. Fortan begleitete der Vorwurf die damalige Migrationskrise und später die Pandemieberichterstattung. Medien wurden in „Systemmedien“ und „alternative Medien“ sortiert.
Erstere würden auf Regierungslinie berichten, wenn sie nicht sogar von oben gesteuert seien – Stichwort „Staatsfunk“ – so geht die Erzählung. „Alternative Medien“ würden dagegen unabhängig informieren und die Wahrheit benennen, ohne Rücksicht auf etablierte Politik und gesellschaftliche Tabus. Eine vermeintliche Spaltung der Medien, die für eine gespaltene Wahrnehmung von Wirklichkeit steht. Natürlich befassten sich die Angesprochenen damals mit dem Vorwurf und wiesen ihn umgehend zurück.
So schrieb der Spiegel im Februar 2016 von Gerüchten, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe Journalisten großer Verlage ins Kanzleramt eingeladen, um mit ihnen auszumachen, wie über das alles beherrschende Flüchtlingsthema zu berichten sei. „Solche Runden gibt es nicht“, stellte der Spiegel damals klar. Um dann zu relativieren: Was es gebe, seien sogenannte Hintergrundgespräche, zu denen von Ministern und Kanzlerin eingeladen werde, „das ist ein normaler Vorgang.“ Sie dienten nicht dazu, sich Weisungen abzuholen, sondern Informationen zu erlangen.
Im geschützten Kreis gäben Politiker Dinge preis, die sie öffentlich nie sagen würden. Journalisten dürften aus diesen vertraulichen Gesprächen zwar nicht zitieren. Aber sie dürften die Informationen für ihre Berichte verwenden.Ein „normaler Vorgang“? Wer bis dahin noch nie von der öffentlich selten diskutierten Institution des Hintergrundgesprächs gehört hat, bekam hier eine Variante staatlicher Informationstätigkeit erklärt, die eine Fülle von Problemen birgt. Allem voran geht es um Transparenz. Wenn Minister oder ein Kanzler Journalisten einladen, um Informationen zu teilen, handeln sie als Amtsträger.
Für Journalisten gilt die Pflicht zur Wahrheit und Klarheit, die prinzipiell auch die Nennung des Ursprungs einer Information umfasst. Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, woran sie sind und wer sie informiert. Ein Journalist, der recherchiert hat, oder mittelbar der Staat selbst? Damit kommen wir schon zum Problem: Die verabredete Vertraulichkeit bei Hintergrundgesprächen verhindert dies.Journalisten verbreiten Fakten und Einschätzungen aus staatlicher Sphäre, ohne ihrem Publikum deren Herkunft zu benennen. Sie mögen dies kritisch, abgewogen und alles andere als willfährig tun – aber sie tun es.
Quellenschutz nur vorgeschoben
Die Rolle von Journalisten als Objektivitätsgaranten, Informationsbeschaffer und Kontrolleure der Staatsgewalt wird mit dieser Bereitschaft prekär. Der Konflikt spiegelt sich beispielhaft in dem Missverständnis, dass die Vertraulichkeitsvereinbarung mit Behörden dem journalistischen Quellenschutz diene.Staatliche Akteure, die im Rahmen ihrer Befugnis zur staatlichen Öffentlichkeitsarbeit Journalisten informieren, können keine schutzwürdigen Informanten im Sinne des Pressekodex sein. Selbst dann nicht, wenn sie Vertraulichkeit verlangen. Berufen sie sich trotzdem darauf, liegt Verdacht auf Missbrauch vor.
Andersherum widerspricht die Vertraulichkeit, auf die sich Journalistinnen und Journalisten auf Behördenwunsch einlassen, ihrer öffentlichen Aufgabe, wie sie in den Landespressegesetzen niedergelegt ist. Wer Nachrichten beschaffen und redlich an Meinungsbildung mitwirken soll, muss seine Berichterstattung möglichst nachprüfbar gestalten und, soweit nötig, mit Quellen belegen. Dass dies bei „unter drei“ aus Prinzip nicht gemacht wird, müsste genug Anlass bieten, den Umfang von Hintergrundgesprächen auf begründete Ausnahmefälle zu beschränken.
Doch das Gegenteil ist der Fall. „Unter drei“ gehört zum Alltag in deutschen Redaktionen und hat Pressekonferenzen vielfach ersetzt. „Unter drei“ informieren Pressestellen von Bundes- und Landesbehörden. „Unter drei“ kommunizieren Ministerien und Kanzleramt, das Auswärtige Amt nutzt „Verwendungsvorgaben“ sogar in Antworten auf schriftliche Fragen. Der Verfassungsschutz spricht „unter drei“ und auch der Bundesnachrichtendienst, der seine amtliche Medieninformation fast nur in dieser Form gestaltet.
Die Chiffre „unter drei“, entlehnt aus der Satzung der Bundespressekonferenz, erleichtert und beschleunigt den Austausch vor allem aus Sicht der Behörden. Statt sich zitierfähig „unter eins“ voll verantwortlich präsentieren zu müssen, können sie Informationen und Ansichten streuen, ohne Rückschlüsse auf den amtlichen Absender und dessen Interessen zu riskieren.
So konnten Teilnehmer der Hintergrundgespräche im Bundesamt für Verfassungsschutz berichten, wie der damalige Chef Hans-Georg Maaßen „unter drei“ Front gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik machte.
„Lieber lässt man sich auf Gespräche ‚im Hintergrund‘ ein, um kurzfristig an Informationen zu gelangen, als mit einer Behörde um Auskünfte ‚unter eins‘ zu streiten, im Zweifel langwierig und vor Gericht.“
In der Coronazeit ließen sich Journalisten „unter drei“ ins Kanzleramt schalten und auf Alarm einstimmen, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz neue Schutzmaßnahmen beschloss. „Unter drei“ erklärte der damalige Chef der Regierungszentrale Wolfgang Schmidt, wie sich Kanzler Olaf Scholz im Herbst 2024 für den Bruch mit der FDP präparierte und vermutlich auch, wie er, Schmidt selbst, mit BND-Erkenntnissen zum Ursprung des Coronavirus verfuhr, die kürzlich Schlagzeilen machten. Eine Kooperation von Medien und Staat, auf der vermutlich eine Vielzahl vermeintlich investigativer Recherchen gründet. Verständlich, dass die Beteiligten darüber schweigen, sie ziehen gemeinsam Profit daraus. Allerdings entsteht der Eindruck, dass hier ein Zusammenspiel stattfindet, das besser unentdeckt bleiben soll.
„Die Mächtigen korrumpieren die Journaille ja nicht mit Geld, sondern mit exklusiven Interviews, der Teilnahme an vertraulichen Beratungen und Hintergrundgesprächen und dem Zustecken exklusiver Informationen“, resümierte einst Focus-Gründer Helmut Markwort. Das ist zugespitzt, wie Journalisten es eben machen. Aber es tri.t den Kern. Wie sollen die Medien angesichts dieser Umstände die Öffentlichkeit umfassend und wahrheitsgemäß über „Geschehnisse von öffentlichem Interesse im staatlichen Bereich“ unterrichten, wie es das Bundesverfassungsgericht für eine wesentliche Aufgabe hält?
Schwierig. Schwieriger noch, da das Karlsruher Gericht eben dafür eigentlich einen presserechtlichen Auskunftsanspruch von Journalisten gegenüber staatlichen Stellen vorsieht. Dadurch sollen Bürger „Informationen über tatsächliche Vorgänge und Verhältnisse, Missstände, Meinungen und Gefahren erhalten, die ihnen sonst verborgen bleiben würden“.
Dieser Auskunftsanspruch ist es, der eigentlich komplementär zur staatlichen Öffentlichkeitsarbeit steht. Was der Staat willkürlich an Information verweigert, kann und soll auf diesem juristischen Weg ans Licht gebracht werden. Mit der „unter drei“-Praxis hat sich aber eine eigenständige dritte Form entwickelt, eine Art Zwischenwelt. Ein vertraulicher „Austausch“, der es staatlichen Stellen ermöglicht, bestimmte Journalistinnen und Journalisten in amtliche Kenntnisse einzubeziehen, während der förmliche Anspruch anderer Presseleute auf offizielle „unter eins“-Informationen routinemäßig unterlaufen und abgelehnt wird, mit Floskeln wie „dazu führen wir keine Statistik“ oder „zu internen Vorgängen geben wir grundsätzlich keine Auskunft“.
„Wer nicht passt, fliegt. Das Kanzleramt meint, es wähle pluralistisch und sachgerecht aus – aber wer kommen darf, wer gehen muss, wer ein Einzelgespräch bekommt, wer nicht, das alles bestimmen Behörden allein und im Geheimen.“
Das zeigt, weshalb der presserechtliche Anspruch auf Auskunft als Instrument nicht nur des investigativen Journalismus weiterhin ein Schattendasein führt. Er wird in vielen Fällen durch das massive Angebot an „unter drei“-Austausch hinfällig. Lieber lässt man sich auf Gespräche „im Hintergrund“ ein, um kurzfristig an Informationen zu gelangen, als mit einer Behörde um Auskünfte „unter eins“ zu streiten, im Zweifel langwierig und vor Gericht.
Es kann verlockend sein, behördliche Perspektiven und Einschätzungen als sachkundiges Ergebnis eigener Arbeit zu präsentieren: Was nach unabhängiger Recherche aussieht, ist in Wahrheit eine amtliche Zulieferung gewesen. Auf diese Weise haben sich Vertraulichkeitskartelle gebildet. Nur jene bekommen Einblick, die bereit sind, ein Teil davon zu werden. Zwar gibt es mittlerweile verschiedene gerichtliche Urteile und Beschlüsse zur Transparenz von Hintergrundgesprächen beim BND. Doch wann immer es möglich erscheint, weichen insbesondere die Regierungsbehörden ihnen aus. Und die beteiligten Medien sagen nichts – sie haben ja Vertraulichkeit versprochen.
Ein Arrangement, das schon lange fragwürdig war und mit dem Erstarken des Rechtspopulismus unter größeren Erklärungsdruck gerät. Nicht nur, weil mit dem verdeckten Zusammenspiel von Staat und Medien zu beider Vorteil der „Lügenpresse“- Vorwurf an Substanz gewinnt. Sondern auch, weil rechtspopulistische Akteure das Instrumentarium irgendwann auf ihre Art nutzen könnten.
Als abschreckendes Beispiel könnte die US-Administration mit ihrer Entscheidung dienen, die Nachrichtenagentur AP von den Pressebriefings im Weißen Haus auszuschließen.
Kein Recht auf Teilnahme
In den Hintergrundkreisen der deutschen Regierungsbehörden wäre Vergleichbares ebenfalls denkbar. Wer nicht passt, fliegt. Das Kanzleramt meint, es wähle pluralistisch und sachgerecht aus – aber wer kommen darf, wer gehen muss, wer ein Einzelgespräch bekommt, wer nicht, das alles bestimmen Behörden allein und im Geheimen.Dass die Justiz einschreitet, wäre – Stand heute – kaum zu erwarten. Erst kürzlich entschied das Bundesverwaltungsgericht, aus dem Auskunftsanspruch sei kein Recht für Journalisten auf eine Teilnahme an Hintergrundkreisen abzuleiten.
Auch der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz soll dafür nicht herangezogen werden können. Im Ergebnis: Der Staat bestimmt selbst, mit wem er bevorzugt sein Wissen teilt. Dass das pluralistisch und nach sachlichen Kriterien erfolgt, bleibt eine Behauptung, die sich kaum nachprüfen lässt. Recherchen seien geschützt, heißt es dann auf Anfrage. Mit solchen Vorgaben kann die Justiz kritische Medien schlecht beschützen, wenn sie, der Tag möge fern sein, von autoritären Rechten aus vertraulichen Journalistenzirkeln einer Regierung hinausbefördert und durch gewogene Berichterstatter aus „alternativen“ Medien ersetzt werden.
Die Medien können sich nur selbst schützen: indem sie, statt vertraulich mit Behörden zu kooperieren, die rechtlich vorgesehenen Wege beschreiten, um an Informationen aus der Exekutive zu gelangen und sie dann auch als solche öffentlich – „unter eins“ – zu benennen.
Tendenzen in diese Richtung gibt es. Immer öfter greifen Medien auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zurück und vor allem auch auf den presserechtlichen Auskunftsanspruch, um Behörden zu Auskünften „unter eins“ zu verpflichten. Als die Union in den Koalitionsverhandlungen die Idee einbrachte, das IFG zu stutzen, gab es berechtigterweise eine Welle der Empörung.
Das Bundesverfassungsgericht hat seine langjährige fatale und letztlich rechtswidrige Praxis abgeschafft, denjenigen Journalisten vorab Urteile zukommen zu lassen, die in der Karlsruher „Justizpressekonferenz“ zusammengeschlossen sind.
Sie bekamen Urteile sogar früher als die Prozessbeteiligten. Ein Geschehen, das so gut abgeschirmt war, dass nur die wenigen Eingeweihten davon wussten. Vermutlich würde auch der Spiegel nicht mehr so gedankenlos darüber schreiben, wie er es damals tat. Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit sagt heute zu dem Thema: „Da ist die Welt, die wir als Journalisten erkennen. Und die Welt, die wir unseren Lesern erzählen. Wenn ich sehr wesentliche Dinge erfahre, über die ich auf Wunsch der Politiker nicht berichten soll, dann funktioniert mein Beruf nicht.“
Jost Müller-Neuhof ist Rechtspolitischer Korrespondent des Tagesspiegels. Als Journalist und Syndikusrechtsanwalt hat er zahlreiche Gerichtsverfahren auf Grundlage presserechtlicher Auskunftsansprüche sowie des Informationsfreiheitsgesetzes geführt.